Modernisierung refinanzieren - welche Chancen bietet der Markt?
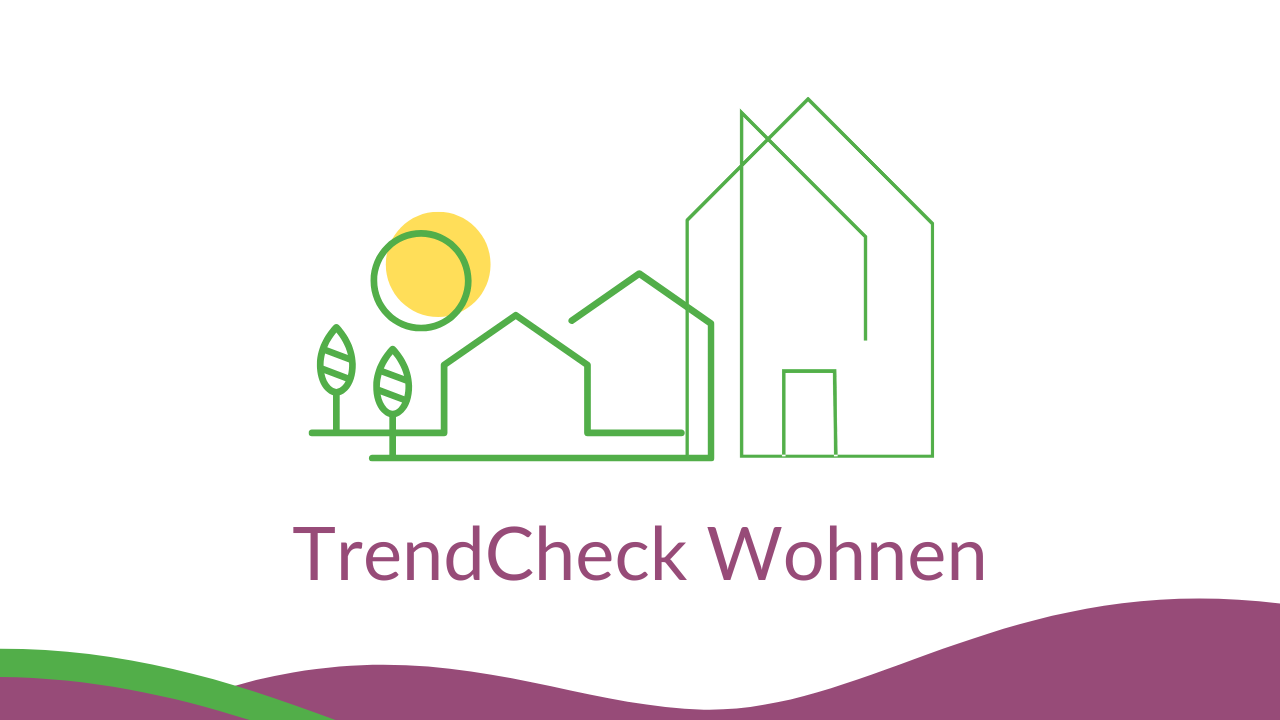
Weiterlesen
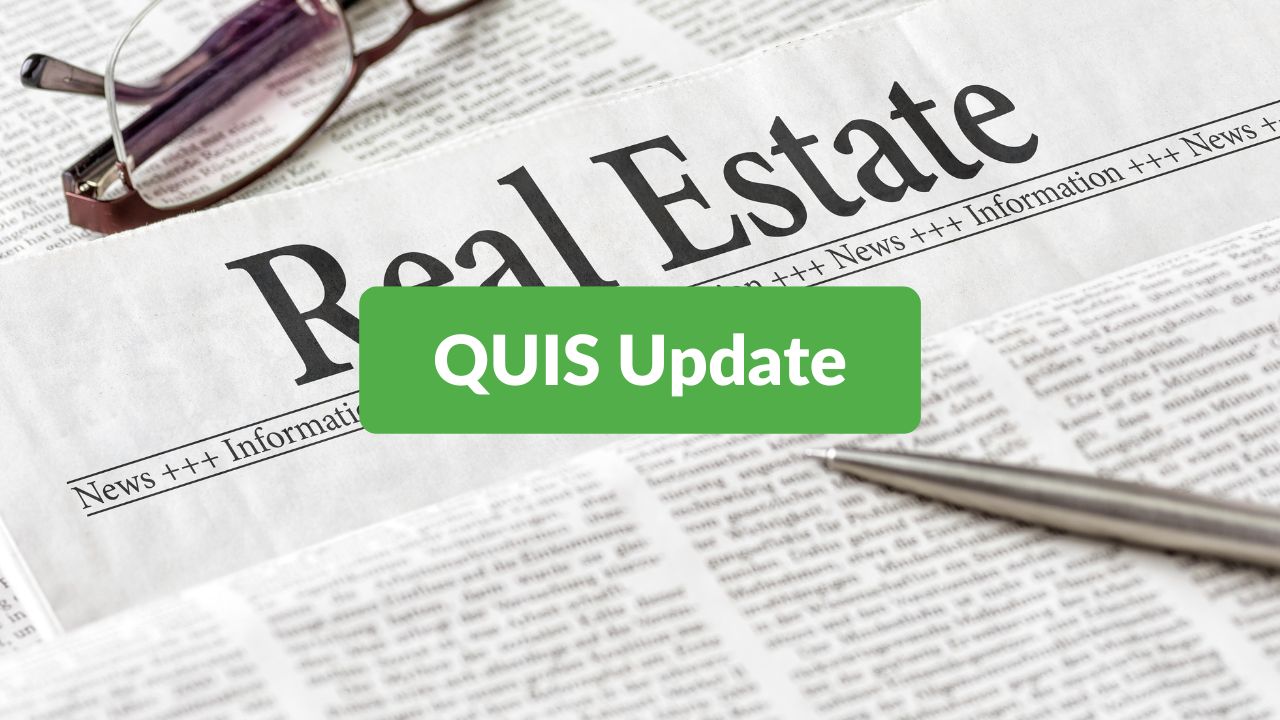
Mietmarktanalyse mit Quis: Mietspiegel und Mietrecht in Deutschland
Die Entwicklung der Mieten im lokalen Wohnungsmarkt wird zum einen durch Angebot und Nachfrage bestimmt; zum anderen unterliegen Mietwohnungen einer ganzen Reihe von mietrechtlichen Regulierungen, die einen Einfluss auf die erzielbaren Miethöhen...
CO₂-Kosten & Mieten: Wie beeinflusst Energieeffizienz die Miethöhe?
Steigende CO₂-Kosten erfordern Investitionen in Energieeffizienz. Doch lassen sich diese über Mieterhöhungen refinanzieren? Der Einfluss auf die Miethöhe wächst - mit regionalen Unterschieden und wirtschaftlichen Herausforderungen für Vermieter.
Mietbelastung bei Bestandsmaßnahmen im Blick behalten
Die Wohnkosten bilden für die meisten Menschen mit den größten Posten bei den Haushaltsausgaben. Wieviel für das Wohnen ausgegeben werden kann, bestimmt nicht nur die Wohnform, sondern sehr stark auch die Wahl des Wohnortes. Haushalte mit höheren...Die Finanzierung von Modernisierungen bleibt eine der größten Herausforderungen der Wohnungswirtschaft. In unserem aktuellen TrendCheck Mai 2025 zeigen wir, wie sozialverträgliche Mieterhöhungen, kluge Objektstrategien und gezielte Datennutzung zu einer erfolgreichen Entwicklung führen.
1. Fördermittel allein schließen die Finanzierungslücke bei Modernsierungen nicht - ohne Miet-Cashflow geht es nicht: Staatliche Programme decken nur einen geringen Teil der Klimasanierung; die Modernisierungsumlage und stärker marktorientierte, aber sozialverträgliche Neuvermietungsmieten sichern die Tilgungslast.
2. Sozialverträgliche Mietanpassungen brauchen datengestützte Marktkenntnis: Wer Bewohnereinkommen, Mietbelastung und lokale Marktmiete quartiersgenau kennt, kann Potenziale gezielt nutzen und Haushalte mit niedrigen Einkommen zugleich schützen.
3. Zusätzliche Erlöse bei gerechten Mieten entstehen durch kluge Objektstrategie: Vorrang für Gebäude mit geringem Sanierungsaufwand und niedriger Mietbelastung, eine Kombination von „Low-Hanging-Fruits“ und Quartiersansätzen ermöglicht verträgliche Umlagen und sichern Akzeptanz.
Die Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen stellt für viele Wohnungsunternehmen eine große Herausforderung dar. Dabei geht es aktuell insbesondere um die anstehenden Investitionen im Rahmen des Klimapfads, letztendlich aber um alle notwendigen Maßnahmen, die zu einer guten und langfristig sicheren Vermietbarkeit der Bestände führen.
Für die Maßnahmen kommen mehrere Finanzierungsquellen und -instrumente in Betracht, die sich jeweils unterschiedlich stark auf die Mieten auswirken.
Von besonderer Bedeutung sind aktuell vor allem Fördermittel (KfW, Länder, EU), insbesondere angesichts von begrenzten Mieterhöhungsmöglichkeiten und den Grenzen des Cash Flows in vielen Unternehmen. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass diese Mittel nicht ausreichen werden und nur einen geringeren Teil der Maßnahmen werden finanzieren können.
Daher müssen auch die Mietspielräume in die Betrachtung einbezogen werden, da ein Teil der Kosten über Modernisierungsumlagen auf die Mieterschaft umgelegt werden kann und Neuvermietungsmieten in Richtung Marktmiete angepasst werden können. Die Finanzierungslücke zwischen Fördermitteln, Krediten und Eigenkapital kann letztendlich nur über auskömmliche Mieten geschlossen werden.
Mietenpolitik im Spannungsfeld
Gleichzeitig stehen Vermieter jedoch vor der Herausforderung, sozialverträgliche Mieten zu gewährleisten und den Spagat zwischen Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und bezahlbarem Wohnen zu meistern. Die Mietenpolitik der Wohnungsunternehmen steht im Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen, gesetzlichen Vorgaben und gesellschaftlicher Verantwortung.
Bei den GdW-Mitgliedsunternehmen, für die eine sozial verantwortliche Vermietung zentral ist, liegen die Neuvermietungsmieten sehr deutlich unter den Angebotsmieten der Vermietungsportale. Diese Orientierung ist sozialpolitisch extrem wichtig und bildet einen wichtigen Faktor auf dem Wohnungsmarkt. Die Daten zeigen aber auch, dass es - ohne die Grundorientierung aufzugeben - an der einen oder anderen Stelle Möglichkeiten gibt, den Mieten zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen ein größeres Gewicht zu verleihen.
 In diesem Spannungsfeld wird es daher eine der zentralen Herausforderungen sein, die Potenziale, die sich aus höheren Mieten ergeben können, mit sozialem Augenmaß zu nutzen. Eine reine Orientierung an den Marktmieten würde zwar ökonomisch die größten Effekte bringen, wäre aber mit sozialen Zielen nicht vereinbar. Andererseits wohnen auch bei diesen Unternehmen einkommensstärkere Bewohnergruppen, die über höhere Mieten einen Beitrag zur Refinanzierung von Modernisierungsmaßnahmen leisten könnten. So finden wir etwa in QUIS in nahezu allen Städten in nennenswertem Umfang Wohnquartiere, die auch bei mittleren Einkommen eine eher geringe Wohnkostenbelastung von unter 25 % aufweisen und wo entsprechende Potenziale bestehen.
In diesem Spannungsfeld wird es daher eine der zentralen Herausforderungen sein, die Potenziale, die sich aus höheren Mieten ergeben können, mit sozialem Augenmaß zu nutzen. Eine reine Orientierung an den Marktmieten würde zwar ökonomisch die größten Effekte bringen, wäre aber mit sozialen Zielen nicht vereinbar. Andererseits wohnen auch bei diesen Unternehmen einkommensstärkere Bewohnergruppen, die über höhere Mieten einen Beitrag zur Refinanzierung von Modernisierungsmaßnahmen leisten könnten. So finden wir etwa in QUIS in nahezu allen Städten in nennenswertem Umfang Wohnquartiere, die auch bei mittleren Einkommen eine eher geringe Wohnkostenbelastung von unter 25 % aufweisen und wo entsprechende Potenziale bestehen.
Detaillierte Kenntnisse des Marktumfeldes sind unabdingbar
Eine gute, sozial verträgliche Ausschöpfung von Mieterhöhungspotenzialen setzt auf jeden Fall eine differenzierte Kenntnis des eigenen Bestandes, seiner Bewohnerstrukturen und der lokalen Marktgegebenheiten voraus. Während bei der Entwicklung von Bestandsstrategien die technischen und die kaufmännischen Faktoren vergleichsweise gut aufbereitet sind, fehlt es oftmals noch an einer belastbaren Einordnung der Bestände im Hinblick auf die Potenziale aus Marktmieten und Mieterhöhungsspielräumen. Ebenfalls einbezogen werden müssen hier Regulierungen, etwa durch Mietspiegel, und die aktuellen und zu erwartenden Mietbelastungen der Bewohner.
Um den Miet-Cashflow bestmöglich auszuschöpfen sind zwei Handlungsfelder entscheidend:
- Bei Neuvermietung dort eine Annäherung an die ortsübliche Marktmiete vornehmen, wo heutige Bestandsmieten deutlich darunter liegen. Hierfür kann es erforderlich sein, die Mietenpolitik des gesamten Unternehmens zu überprüfen und gegebenenfalls mit einem breiteren Spektrum zu justieren.
- Die Modernisierungsumlage als begrenzter Cash-Flow-Booster: Bis zu 8 % des aufgewendeten Kapitals für die Modernsierungen dürfen auf die Jahresmiete umgelegt werden; das deckt - je nach Investitionshöhe - erfahrungsgemäß rund 30-50 % der Tilgungs- und Zinslast. Damit kann die Umlage einen Teil der Kreditrate bedienen bzw. weitere Projekte ermöglichen. Zusätzlich zur 8-%-Grenze greift die absolute Kappung von +3 €/m² binnen 6 Jahren sowie regionale Kappungsgrenzen (15–20 % in 3 Jahren). Unternehmen mit sozialem Auftrag (kommunal, Genossenschaft) unterschreiten diese Limits oft freiwillig, um Verdrängung zu vermeiden. Problematisch ist allerdings die Regelung, dass gerade dort, wo die Miete unter 7 € lag sind, nur +2 €/m² in 6 Jahren in Ansatz gebracht werden können, denn hier sind erfahrungsgemäß die größten Investitionen notwendig.
- Gleichzeitig steigt auch durch die Modernisierungsumlage die Herausforderung, sozialverträgliche Mieten insbesondere für Haushalte mit geringen Einkommen zu erhalten. Gerade im bezahlbaren Wohnraum ist die Modernisierungsumlage daher oft politisch und gesellschaftlich umstritten. Daher sollte sich die Modernisierungsförderung auf diese Bestände konzentrieren.
Modernisierungen strategisch planen
Ein weiterer Aspekt zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen mit Marktmieten bildet die strategische Auswahl der Objekte.
So kann es einen Vorrang für Häuser geben, in denen die Ist-Miete deutlich unter Marktniveau liegt und die Mietbelastungsquote niedrig ist. Allerdings darf es sich nicht um Objekte mit einem übermäßigen Modernisierungsbedarf handeln (worst first), da hier i.d.R. keine Rentabilität erreicht werden kann. Erfolgversprechender ist vielmehr eine Kombination mit "Low-Hanging-Fruits": Wo der Effizienzsprung mit moderatem Mitteleinsatz gelingt (Dachbodendämmung, Wärmepumpe und Hydraulikabgleich), lassen sich Umlagen unterhalb der Kappungsgrenzen halten.
Weiterhin ist ein Plan-B für schwierige Bestände erfolgversprechend: In Quartieren mit geringen Mieten, aber auch geringen Einkommen lohnt oft ein Quartiersansatz mit folgenden Komponenten: Bündelung mehrerer Blöcke, Fördermaximierung, längere Amortisationspfade, Misch-Refinanzierung über Neubau-Erlöse oder Cross-subvention aus renditestarken Standorten.
Sozialverträgliche Mieterhöhungen setzen auf frühzeitige Kommunikation, Transparenz und einen schrittweisen Anstieg der Mietbelastung. Härtefallregelungen, gezielte Förderung und Dialog mit den Mieterinnen und Mietern sind zentrale Stellschrauben, um die Auswirkungen von Modernisierungsmaßnahmen oder anderen Kostensteigerungen abzufedern. Darüber hinaus kann die Integration von ESG-Kriterien und eine solide Fördermittelstrategie dazu beitragen, den Anteil der Kosten, der letztlich auf die Mieterschaft umgelegt wird, möglichst gering zu halten - und damit langfristig ein vertrauensvolles und stabiles Mietverhältnis zu sichern und gleichzeitig die Erlöse aus den Mieteinnahmen nennenswert zu steigen.
Der vollständige TrendCheck Wohnen bietet Ihnen weiterführende Analysen und Handlungsempfehlungen – laden Sie den Bericht jetzt herunter.
Weiterlesen
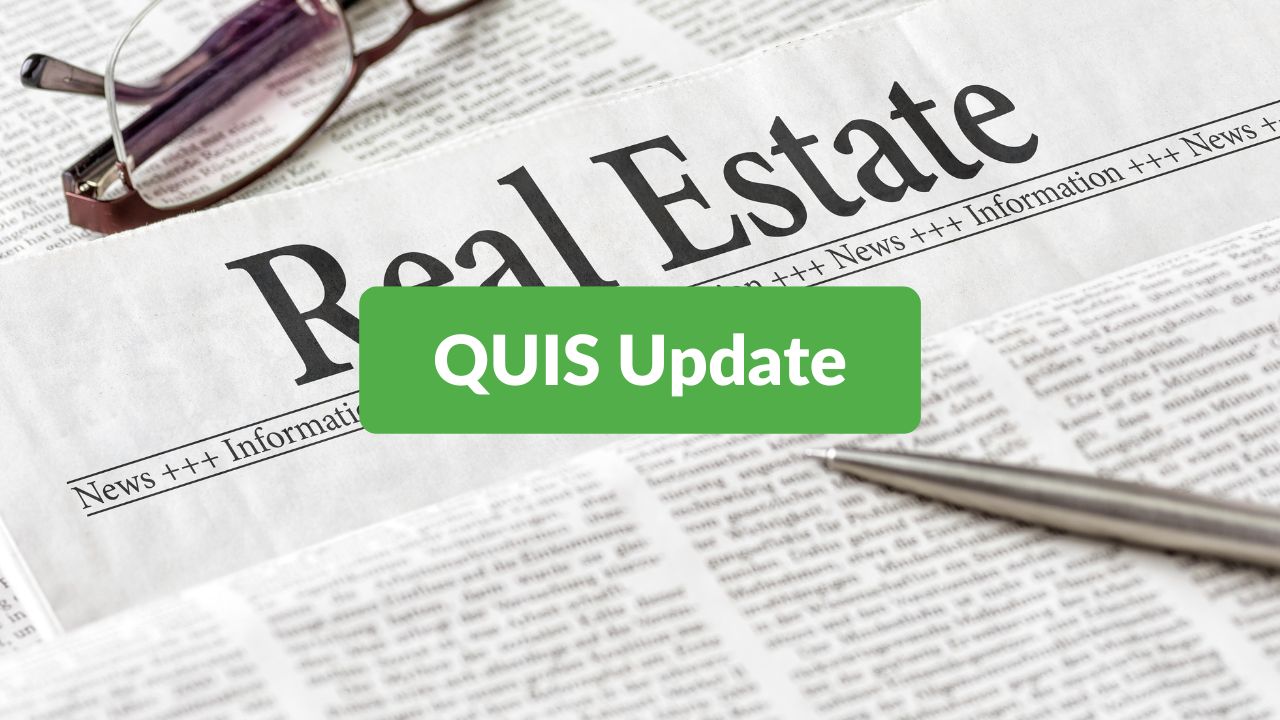
Mietmarktanalyse mit Quis: Mietspiegel und Mietrecht in Deutschland
Die Entwicklung der Mieten im lokalen Wohnungsmarkt wird zum einen durch Angebot und Nachfrage bestimmt; zum anderen unterliegen Mietwohnungen einer ganzen Reihe von mietrechtlichen Regulierungen, die einen Einfluss auf die erzielbaren Miethöhen...
CO₂-Kosten & Mieten: Wie beeinflusst Energieeffizienz die Miethöhe?
Steigende CO₂-Kosten erfordern Investitionen in Energieeffizienz. Doch lassen sich diese über Mieterhöhungen refinanzieren? Der Einfluss auf die Miethöhe wächst - mit regionalen Unterschieden und wirtschaftlichen Herausforderungen für Vermieter.

