Die Sharing-Economy in der Wohnungswirtschaft

Inhalte des Beitrags
Weiterlesen



Drei Zimmer, Küche, Bad, am liebsten mit Balkon oder Garten, gut angebunden, renoviert und natürlich bezahlbar – so oder ähnlich liest sich die Wunschliste vieler Wohnungssuchender in Deutschland. Gerade in deutschen Großstädten wird es allerdings immer schwerer eine Unterkunft zu finden, die diesen Kriterien entspricht. Denn dort wird der Wohnraum knapper und damit auch immer teurer. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich eine zunehmend drängende Frage: Wie kann kostengünstiger Wohnraum geschaffen werden, der dennoch möglichst hohe Standards erfüllt?
Eine mögliche Antwort könnte sein, vermehrt in Wohnkonzepte zu investieren, die auf der gemeinschaftlichen Nutzung von Flächen basieren. Dieser Beitrag erklärt, welche Grade gemeinschaftlichen Lebens denk- und umsetzbar sind und inwiefern die Wohnungswirtschaft von gemeinschaftlicher Nutzung profitieren kann. Wenn es um das Teilen von Wohnraum geht, sind viele Ansätze möglich: Von eigenen Wohneinheiten mit gemeinsamen Co-Working-Büros und Veranstaltungsräumen bis hin zur weitgehenden Reduzierung des individuellen Wohnraums zugunsten einer Ausweitung gemeinschaftlicher Flächen.Letzterer Ansatz findet wird etwa im Cluster-Wohnen verwirklicht.
Beispiel: Cluster-Wohnungen
Cluster-Wohnungen fungieren als Mischung aus privater Wohnung und Wohngemeinschaft. Bewohnern stehen eigene Räume zur Verfügung, die jedoch auf das Wichtigste reduziert sind: Ein Schlafzimmer, ein kleiner Wohnbereich mit Teeküche und ein Duschbad. Mehrere dieser individuellen Wohnelemente sind dann an einen Gemeinschaftsbereich angeschlossen, der vorrangig aus einer großen Küche und einem Wohnzimmer besteht. Je nach Ausstattung können zu dem Gemeinschaftsbereich noch weitere Elemente wie etwa ein Balkon oder eine Loggia gehören.
Beispiel: Collaborative Living
Noch einen Schritt weiter geht das Collaborative Living. Dort wird der individuelle Wohnbereich auf das Nötigste beschränkt: Das Café im Quartier ersetzt das Wohnzimmer, das Wellnesscenter um die Ecke ergänzt das funktionsorientierte eigene Bad, das Home-Office wird in den nächstgelegenen Co-Working-Space verlegt, Gästezimmer und Küchen können angemietet werden. Die Funktionen des Wohnens werden so ausgelagert und das Private räumlich maximal reduziert.
Beispiel: Co-Housing
Eine weniger extreme Form des gemeinschaftlichen Lebens ist das sogenannte Co-Housing. Co-Housing-Projekte ähneln in ihrer Struktur kleinen Dorfgemeinschaften: Jeder verfügt über eine vollwertig ausgestattete, individuelle Wohneinheit, in der überwiegend gelebt wird. Neben diesem individuellen Wohnraum bieten Co-Housing-Projekte zusätzlich jedoch umfangreiche Gemeinschaftsflächen an. Dies kann etwa ein Gemeinschaftshaus sein, in dem gemeinsame Veranstaltungen stattfinden, ebenso wie zur allgemeinen Nutzung freigegebene Flächen wie etwa Büros oder Spielplätze. So bieten Co-Housing-Projekte den Anwohnern die Privatsphäre einer eigenen Wohnung und gleichzeitig eine eng vernetzte Nachbarschaft.
Ein Beispiel für ein solches Wohnkonzept findet sich in Berlin: Dort wurde mit dem „Projekt Spreefeld“ von einer eigens gegründeten Genossenschaft in den letzten Jahren ein umfangreiches Gemeinschaftsprojekt verwirklicht. Neben Cluster-Wohnungen bietet das Projekt zudem Co-Housing mit gemeinschaftlichen Büroräumen, einer Kindertagesstätte und Veranstaltungsräumen, in denen die Anwohner beispielsweise gemeinsam Sport machen oder Kochkurse organisieren. Bewohner des „Projekts Spreefeld“ kaufen sich mit 1000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in die Genossenschaft ein. Anschließend zahlen sie nur noch für laufende Kosten, Reparaturen und die Nutzung der Gemeinschaftsflächen. Die monatliche Miete liegt dadurch bei etwa 4 bis 6,50 Euro pro Quadratmeter und fällt damit deutlich niedriger aus, als es sonst in Berlin-Mitte üblich ist.
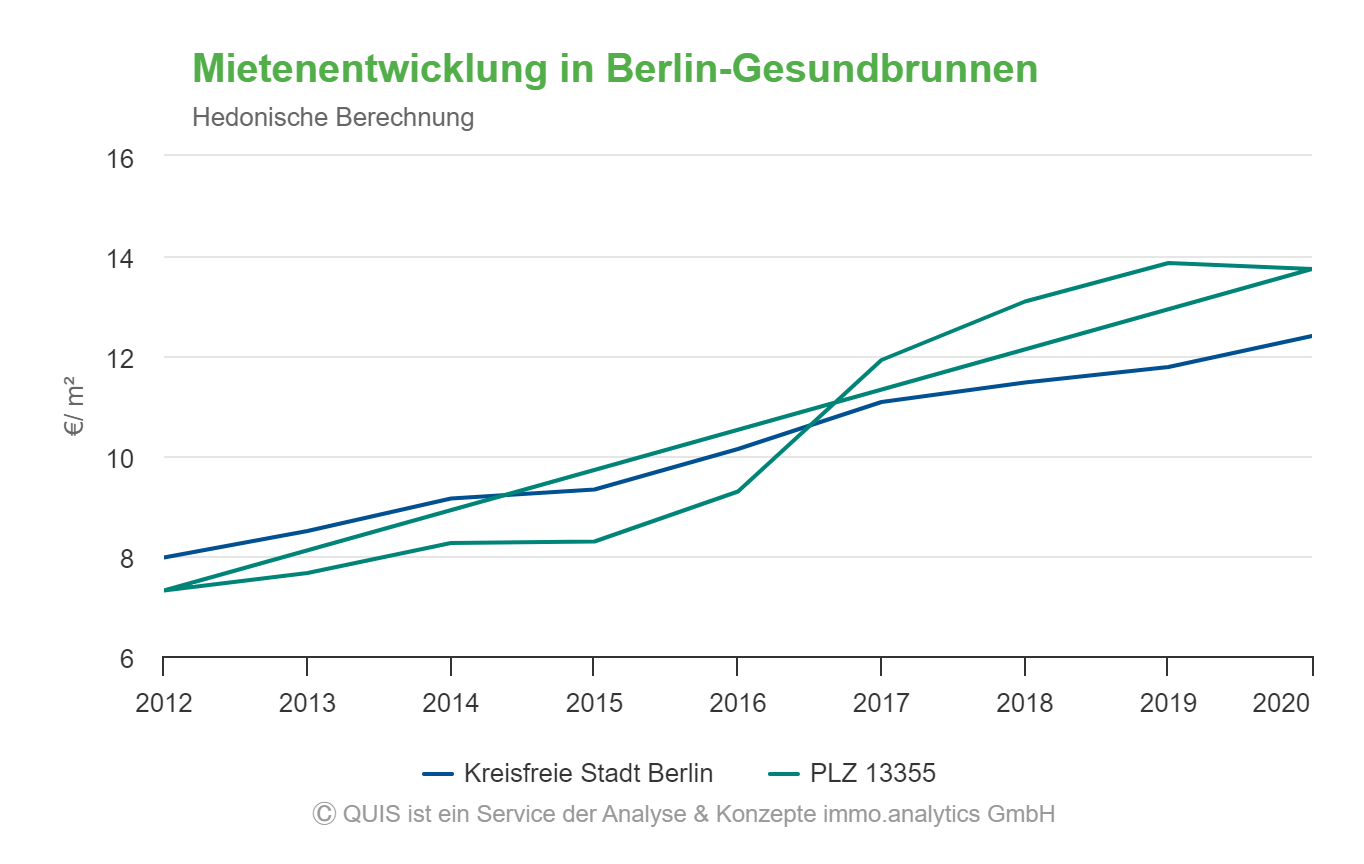 Neben einer finanziellen Ersparnis steht bei entsprechenden Projekten ein weiterer Aspekt im Vordergrund: soziale Einbindung. Der Wunsch nach Gemeinschaft ist weiterhin ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, gleichzeitig verlieren traditionelle soziale Gefüge wie Großfamilien jedoch an Bedeutung. Indem beim Co-Housing Alltagsaktivitäten in einen gemeinschaftlichen Raum verlegt werden, wird Anonymität in der Nachbarschaft überwunden: Man kocht zusammen, feiert zusammen, trainiert zusammen, passt gegenseitig auf die Kinder auf oder hilft sich beim Einkauf. Dass Interessenten diesen sozialen Aspekt als wichtigen Pluspunkt empfinden, zeigt sich an der Verteilung von Co-Housing-Projekten in Deutschland: Diese entstehen nicht nur in preislich angespannten Großstädten, sondern auch in Kleinstädten und auf dem Land. Ein Blick in einzelne dieser Projekte zeigt zudem, dass die Anwohnerschaft oft divers ist – Senioren sind ebenso vertreten wie junge Menschen, Familien ebenso wie Alleinstehende.
Neben einer finanziellen Ersparnis steht bei entsprechenden Projekten ein weiterer Aspekt im Vordergrund: soziale Einbindung. Der Wunsch nach Gemeinschaft ist weiterhin ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, gleichzeitig verlieren traditionelle soziale Gefüge wie Großfamilien jedoch an Bedeutung. Indem beim Co-Housing Alltagsaktivitäten in einen gemeinschaftlichen Raum verlegt werden, wird Anonymität in der Nachbarschaft überwunden: Man kocht zusammen, feiert zusammen, trainiert zusammen, passt gegenseitig auf die Kinder auf oder hilft sich beim Einkauf. Dass Interessenten diesen sozialen Aspekt als wichtigen Pluspunkt empfinden, zeigt sich an der Verteilung von Co-Housing-Projekten in Deutschland: Diese entstehen nicht nur in preislich angespannten Großstädten, sondern auch in Kleinstädten und auf dem Land. Ein Blick in einzelne dieser Projekte zeigt zudem, dass die Anwohnerschaft oft divers ist – Senioren sind ebenso vertreten wie junge Menschen, Familien ebenso wie Alleinstehende.
Verschiedene Formen von gemeinschaftlichen Wohnkonzepten bringen damit unterschiedliche Vorteile mit sich: Während im Cluster-Wohnen und Collaborative Living die privaten Flächen und damit auch die Kosten besonders stark reduziert werden, bieten groß angelegte Co-Housing-Projekte insbesondere die Möglichkeit, durch gemeinsam genutzte Flächen und organisierte Aktivitäten eine starke Nachbarschaft zu bilden. Gemeinschaftliches Wohnen wird vermutlich nicht jeden Traum vom Eigenheim ablösen. Aber die neuen Konzepte können für die Wohnungswirtschaft als wichtige Ideengeber dafür fungieren, wie Flächen anders genutzt und Wohnbestände flexibilisiert und modernisiert werden können. Vielleicht kann eine alte Waschküche testweise zum Co-Working-Space umgebaut oder die ehemalige Turnhalle zum Gemeinschaftshaus umfunktioniert werden. Aufgabe der Wohnungswirtschaft ist dabei, neue Impulse aufzunehmen und mit ihnen zu experimentieren. So entstehen flexiblere Nutzungskonzepte und neue Synergien, die dem Bedarf auf dem Wohnungsmarkt besser gerecht werden können.
Praktischen Anwendungsbeispiele, wie sich geeignete Standorte für alternative Wohnkonzepte in deutschen Großstädten identifizieren lassen, gibt es auch im kostenlosen Whitepaper “Wohnquartiere bewerten in 4 Schritten” zu lesen.
Weiterlesen




